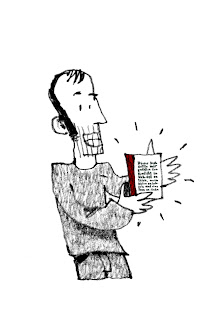Premierenankündigung und Vorbesprechung mit dem Regisseur und Sängern des Musiktheaters
„Der Rosenkavalier“
Premiere am 27. September 2008
Text: Juliane Voigt
Datum: 2008-09-18
Er hat ein beachtliches Gewicht, der Rosenkavalier. Regisseur Professor Anton Nekovar hebt demonstrativ einen voluminösen Klavierauszug in die Höhe. „Wir haben uns hier an ein Opus Maximum herangewagt.“ Der Rosenkavalier, das sei eine der schönsten aber auch schwierigsten und längsten Werke der Opernliteratur. Sagt er. Komponiert von Richard Strauss, uraufgeführt an der Hofoper (heute Semperoper) in Dresden am 26. Januar 1911. Mit so einem triumphalen Erfolg, dass man Zugverbindungen von Berlin nach Dresden einrichten musste. Am nächsten Samstag, am 27. September, ist in Stralsund die Premiere.
„Der Rosenkavalier“ ist eine Oper, über die Kenner sofort ins Schwärmen geraten. Erst einmal ist es ausdrücklich eine Komödie für Musik, schrieb der Komponist unter den Titel. „Eine wienerische Maskerad´ und weiter nix!“ Sie hat Züge einer Operette, andauernd walzt es im Dreivierteltakt, es wienert gar sehr in einer Kunstsprache, es geht komödiantisch zu, clownesk sogar, natürlich rankt sich der Handlungsstrang um unerfüllte Liebe und zwei, die sich am Ende kriegen.
Aber die Oper hat auch einen Unterbau, einen Keller. Wo versteckt man die Tiefe am Besten? An der Oberfläche. Hinter der fast mozartlichen Handlung steckt die straussche Schwere. Um das Vergehen von Zeit geht es, „Wie man nichts halten soll, wie man nichts packen kann, wie alles zerlauft zwischen den Fingern, alles sich auflöst, wonach wir greifen, alles zergeht, wie Dunst und Traum“ singt die Marschallin. Und es ist ein Abgesang an das 19. Jahrhundert. Ein Niederknien vor der schönen Zeit und den alten Werten. Es ist eine Oper, auf die es sich zu warten gelohnt hat. Seit vor zwei Jahren fest stand, dass „Der Rosenkavalier“ als Koproduktion mit der Oper Lecce in Italien, auch auf die Stralsunder Bühne kommen wird. Es ist göttliche, sphärische Musik. Natürlich das Terzett am Ende des dritten Aktes. Und das letzte Duett, ein Suchtmittel fast. Man will nicht, dass es je aufhört. Ein Sirenengesang. Sophie, die Marschallin und Octavia, ein junger Mann, ein 17-jähriger, eine Hosenrolle. Eine Frau also, die eigentlich ein Mann ist, der sich dann aus Verführungszwecken als Frau verkleidet. Wiepke Damboldt musste dreimal um die Ecke denken, um in die Rolle zu schlüpfen. Musikalisch ist jede Stimme mit der anderen verwoben, verheddert und entwirrt sich von Zauberhand. Selten, dass das Orchester eine Melodie führt. Die Sänger singen oft im Parlando, also eher einem Sprechgesang, einen Bogen „und dann hoffen wir, dass wir zusammen ankommen.“ Scherzen sie. Anette Gerhardt singt die Marschallin und hat die Partitur vor zwei Jahren zum ersten Mal in die Hand genommen. Eva Resch betont, sie hätte die Sophie wohl nicht ohne die Einzelproben mit Prof. Husmann so schnell gelernt. Und alle drei Frauen sind dankbar für die Geduld, mit der Henning Ehlert und David Grant am Klavier die Partien mit ihnen geschliffen haben. Ein Oboist hatte zu Strauss gesagt, seine Stimme sei unspielbar, woraufhin der Komponist antwortete: Trösten Sie sich, beim Klavier ist es auch so.
„Am Besten, man kennt die ganze Oper auswendig. Dann kriegt man seinen Einsatz immer. “ Sagt André Eckert. Er ist der Baron Ochs aus Lerchenau, ein verkommener Landadliger. Die Hauptpartie der Oper, die Schwerste. Wer den Ochs schafft, kann man sagen, ist so was wie geadelt in der großen Opernsängerfamilie. Den Ruf, „Der Ochs“ zu sein, den muss man sich hart ersingen. Der Dresdner hat den Ochs schon in vielen verschiedenen Häusern gesungen. Und er kennt die ganze Oper ziemlich sicher auswendig.
„Der Rosenkavalier“ ist eine Herausforderung, auch fürs Publikum. Soviel steht fest. Man muss sich schon auf fast vier Stunden Musik einlassen. Aber wer sich am Ende nicht vollkommen aufgelöst wieder findet und glücklich und zutiefst ergriffen, der ist ein wahrer Ochs aus Lerchenau, jedenfalls einer seiner vielen Verwandten.
Am Sonntag um 11 Uhr findet die Matinee zum Rosenkavalier im Gustav-Adolf-Saal statt.