Dienstag, Juni 03, 2008
Schülerkonzert 1. Sinfonie von Johannes Brahms
Die 1. Sinfonie von Johannes Brahms, c-Moll, op. 68 in der 10. Klasse des Hansa-Gymnasiums. Gähn! Klassische Musik? Wie schrecklich ist das denn. Brahms? Ooch nee! Musiklehrer möchte man da nicht sein. Mit solchen Banausen eine klassische Sinfonie zu erarbeiten, ist wirklich keine dankbare Aufgabe. Oder aber die Schönste, am Ende. Da sitzen sie nämlich und das Herz geht einem auf, wenn sie plötzlich von Brahms reden, als hätten sie einen neuen Freund gewonnen. Die 10 b des Hansa-Gymnasiums und ihr Musiklehrer Martin Hilpp werden am 13. 3. um 10 Uhr das Schülerkonzert im Theater Vorpommern gemeinsam mit GMD Prof. Husmann und dem Philharmonischen Orchester des Theaters Vorpommern bestreiten. Ein Musikunterricht, der es in sich haben wird. „Sie werden diese Musik nie wieder vergessen!“, eine Drohung fast, wie sie im Raum steht. Aber Husmann gibt nur ein Versprechen ab. Fürs Leben. Er ist sich da sicher. Dafür lohnt sich dieser Riesen-Aufwand, ein ganzes Orchester, ein Musikapparat mit ihm als Schaltstelle. Wie in jedem Schülerkonzert, in Stralsund kann man ja fast von Tradition sprechen, stellen die Schüler Komponist und Werk vor und entscheiden selbst, an welchen Stellen der Partitur der GMD den Taktstock heben soll. Auch der freut sich: „Das ist auch für die Musiker sehr interessant. Man kann diese Zusammenarbeit als Werkstatt betrachten. Beide Seiten haben etwas davon.“ Form und Präsentation der Inhalte sind im Unterricht in einzelnen Arbeitsgruppen gut vorbereitet worden. Mit dem Orchester wird es keine Probe geben. Dafür ist der GMD mit der Theaterpädagogin Dorothea Goltzsch in die Schule gekommen. Und erreicht mühelos, mit ruhigem Ernst, Konzentration und Stille, über das Klingelzeichen hinaus. Husmanns Bildersprache ist phänomenal. „Das Thema kommt rein, hat so Trauerkleider an.“ Er spielt es, schleicht herum wie eben ein Thema in Trauerkleidern und singt, die-daa-daa, geht ans Klavier und holt den Seufzer mit geschlossenen Augen aus dem Instrument, doziert „man erkennt es kaum.“ Er sagt aber, das sei die völlig subjektive Deutung eines Musikers, die Schüler sollen es selbst raushören, was immer sie darin sehen. Und siehe da, man erlebt eine Häutung, einen Entwicklungsprozess. Agnete Granitzka gibt als Erste zu, dass diese Schulaufgabe etwas mit ihr gemacht hat. Sie hat ein Interesse für klassische Musik entwickelt. Langsam packen alle aus. Karoline Hassler findet, dass Popmusik so schnell drin ist, wie sie wieder rausfliegt. Und Lisa Geißler meint, Brahms sei wie jede Musik so, dass man sich nur mal darauf einlassen muss, man müsse sie nur oft genug hören, dann kommt es auch an. „Naja, wir reden hier von nem Titel, der ne Stunde geht. Ohne Text.“ mäkelt Hermann Busse kurz im zwar-aber-Tonfall und pflichtet seinem Nachbarn Nick Arndt bei, als dieser sagt, „den Text kann sich doch jeder selber reinhören.“ Die Sinfonie wird im Anschluss an die Präsentation ganz gespielt, schlägt Husmann vor. Und, ja, das wollen sie. Auch wenn es die Schulzeit für Musik entschieden überzieht.
„Republik Vineta“ Schauspiel von Moritz Rinke

„Republik Vineta“, in Stralsund! Großes Lob für die Stückauswahl des Studententheaters der Ernst-Moritz-Arndt-Universität. Vineta, das Synonym diffuser menschlicher Sehnsüchte liegt vor unserer Haustür, versunken in der Ostsee. Näher kommen wir nicht ran, an die Theatergeschichte. Das Schauspiel von Moritz Rinke wurde im Jahr 2001 zum besten deutschsprachigen Bühnenstück gewählt. Als Koproduktion mit dem Theater Vorpommern war es am Dienstagabend auf der Bühne des Gustav-Adolf-Saales zu erleben.
Nein, was bei Rinke untergeht, ist kein Paradies, sondern ein orwellscher Alptraum. Fünf Männer in den besten Jahren sitzen fest in einer alten Villa. Das Stück ist ein Genuss, wenn man das Ende schon vorher kennt. Es geht hier zwar um, wichtigwichtig, die Erschaffung einer „Republik Vineta“ auf einer Insel. Strategiespiel in echt. Dies hier solln sie sein, die berufenen Pioniere, die Besten aus Wirtschaft und Politik, die sich das alles als ganz große Nummer aus ihren genialen Köpfen saugen. Wie sich im zweiten Teil herausstellt, und damit wird das Stück zu einer genialen Komödie, sind sie Opfer eines soziologischen Experimentes, mit dem der größenwahnsinnige Psychiater Dr. Leonhardt die verbissenen Workoholics in den Vorruhestand befördert. Die Villa ist eine insulare Heilanstalt für Arbeitssüchtige. Aber bevor von den vermeintlichen Top-Strategen jemand begreift, dass etwas faul ist, stürzen sie ellenbogenkeilend zur Karriereleiter, die unter dem Gesamtgewicht der armen Irren nur zusammen brechen kann.
Die Inszenierung von Jan Böde (Regie/Bühne/Kostüme) gibt den Schauspielern viel Raum für ihre Sprechrollen, auch auf die Gefahr hin, dass sie insgesamt zu nüchtern, zu behutsam, erscheint. Kahle Bühnenpodeste, völliger Verzicht auf Requisiten, Spieler, die am Rand einfrieren oder lebendig werden und die Handlung fortsetzen. Ihnen allen steht der Kakao, durch den man sie zieht, nicht nur bis zum unteren Rand der etwas peinlichen Leggins, sondern bis zur Oberkante Unterlippe. Obwohl im Mittelteil nicht viel passiert, schwamm man als Zuschauer leichtfüßig mit. Eine erstaunliche Gesamtleistung, die das unterschiedliche Spielspektrum der einzelnen Darsteller in sich aufnahm.
Max Goldt liest aus „QQ“

Stralsund hat eine Menge Vorteile gegenüber einer Großstadt. Neben der großen Badewanne vor der Haustür und dem guten Wetter wird ein Max Goldt scheinbar als Geheimtipp gehandelt. Während er in Berlin erwartet wird wie der Dalai Lama, lümmelten sich hier am Montagabend nur knapp 100 seiner Anhänger in die Sitzreihen des Theaters. Das blieb nicht ohne Wirkung auf den Autor. Enttäuscht sei er, ja, aber nicht zerknirscht. Und wer ihn kennt, weiß ja, dass er seine Geschichten weniger vorliest, als vielmehr vorträgt wie ein Komiker im depressiven Schub.
Sein neues Buch heißt „QQ“ und ist wie gewohnt eine Sammlung kurzer Betrachtungen über zeitgenössische Phänomen. Die wörtliche Bedeutung dieser QQ-Verschlüsselung würde jetzt hier auch nichts zur Sache tun. Man muss jede Goldt-Geschichte sowieso ganzheitlich betrachten. Auch wenn man jedes Wort auch auf die Goldtwaage legen könnte. Das wäre zum Beispiel schon wieder eine dieser Phrasen, die der Meister des Abschweifens auf die Spitze triebe. Es ist nicht amüsant, was er sich ausdenkt. Es ist zum Brüllen komisch. Hemmungslos schallend wurde über seine Verhedderungen gelacht. Zum Beispiel die Geschichte mit dem Vorschlag, im Frühherbst einen gesellschaftslähmenden und wirtschaftsschädigenden Doppel- bis Dreifachfeiertag einzuführen. „Masern“ würde er das nennen, auch egal, warum ausgerechnet Masern Aber es klingt gut. „An Masern Masern haben, haha.“ Eine Geschichte, die dem Verbraucher auf grausame Weise alle langen Wochenenden vergällt. Oder die Geschichte über zu gut gemeinte Pünktlichkeit, über Zufrühkommer. Das sei jetzt nicht sexuell gemeint, sondern in Erwartung von Gästen, Messis bräuchten wegen der vielen, oft toten Katzen („die Katze da, die schnurrt doch jetzt nicht mehr so direkt …?) nicht mit Besuch rechnen, aber so ein Sozialleben beinhalte eben auch das Gäste-Ein-und-Aus. Und nichts sei schlimmer als zu früh zu kommen. Er schweift ab, erfindet den Begriff „Pünktlichkeit Plus“, landet bei Apple Plus, Apfelschorle, das Giro-Konto-Plus, das man ja jetzt auch Schorle nennen könnte und endet bei einem Antrag nach Brüssel, die EU künftig „Germany Plus“ zu nennen. Hoffentlich kommt er wieder. Wir organisieren auch Shuttle-Busse aus den fernen Metropolen.
Winfried Glatzeder liest aus seinem Buch „Paul und ich“

Er hängt ihm an wie ein klebriges Bonbonpapier, wie ein nervender kleiner Bruder. Dieser Paul. Immer wenn man Glatzeder sah, hieß es: Das war doch der Paul!? Dieser kultigste Liebhaber der DDR-Filmgeschichte. In bed with Angelika. „Paul und Paula“ waren sie. Er hat ja danach auch noch eine Menge andere Film- und Theaterrollen gespielt und zwar so, dass er mal sinngemäß sagte, dass alle seine Rollen Traumrollen sind, weil sie ihn bis in den Traum verfolgen. Aber dieser Paul, der ist in sein kantiges und verhext altersloses Gesicht gemeißelt, das er seit 35 Jahren wie ein siamesischer Zwilling mit dieser Filmfigur teilen muss. Insofern ist es die weise Einsicht in Dinge die man nicht ändern kann und nicht, wie es auch vermuten lässt, der Hinweis auf eine Persönlichkeitsstörung, dass er seine Autobiografie „Paul und ich“ genannt hat. Winfried Glatzeder ist auf Lesereise und war am Sonntagabend im Theater. In der Mitte der Bühne.
Die erste Begegnung mit seiner Mutter sei ein Schock gewesen, liest er vor. Nein, nicht nach der Geburt die. Erst mit fünf Jahren, nach Jahren zwischen Kinderheim und Großmutter, sieht er sie, die mit TBC in der Lunge in die Quarantäne gezwungen war. Es wird nicht mehr richtig gut mit den Beiden. Den Vater erlebte er nie. Die Geschichte reicht, um zu ahnen, dass unter der laxen und kantigen Erscheinung dieses Schlacks ein ordentliches Verließ zu vermuten ist. Und so sprüht sein Wortwitz durch den Raum, er inszeniert kapitelweise, monologisiert, schweift ab, so dass sich dem Zuschauer ein Glatzeder-Universum erschließt, eins ums nächste, selten kriegt er noch den Ariadnefaden zu fassen, um zurückzukehren zu Buch und Bühne. Aber da steht eben auch der erklärte Exbettnässer und Hypochonder auf einer entstaubten Bühne und verteilt an hustendes Volk Eukalyptusbonbons. Bakterienflug oder akustische Störung, wie auch immer. Dünnhäutig kämpft er um die totale Aufmerksamkeit und kriegt sie, kein Gähnen bleibt unkommentiert und je hippeliger die Zuschauer an ihren Nachtbus denken, um so mehr überzieht er eben. Das sind die Kellerbesichtigungen dieses unverwechselbaren Schauspielers. Das Andere war eine professionelle Bühnenshow, der Lesetipp für ein Buch über eine Menschwerdung als Künstler und eine ausgedehnte Autogrammstunde. Der Nachtbus war eh weg.
„Dieses Buch sollte mir gestatten, den Konflikt in Nah-Ost zu lösen, mein Diplom zu kriegen und eine Frau zu finden“
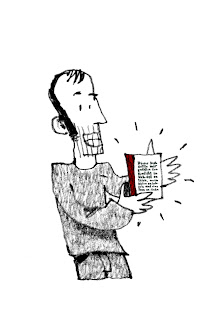
Sylvain Mazas ist 26 Jahre alt und hat sich vorgenommen, die Welt zu verbessern. Dafür stehen ihm eine Gitarre, ein Haufen Freunde, seine Eltern und sein Zeichentalent zur Verfügung. Im Mückenschweinverlag ist aktuell sein Erstlingswerk erschienen. Ein Comic, auf dessen grauem Pappdeckel der inhaltsschwere Titel prangt „Dieses Buch sollte mir gestatten, den Konflikt in Nah-Ost zu lösen, mein Diplom zu kriegen und eine Frau zu finden“. Es ist „Teil 1“, wohlgemerkt, der hier vorliegt. Sylvain Mazas hat damit sein Diplom bestanden. An der Kunsthochschule in Berlin Weißensee. Und hängt schon mal an die große Glocke: „Mit dem 2. Und 3. Teil löse ich den Nah-Ost-Konflikt und finde eine Frau“. Wenn das mit dem 1. Teil so gut geklappt hat, dann gibt’s an seinen Vorhaben wohl keinen Zweifel.
Das Buch hat sich vor Weihnachten so gut verkauft, dass die Produktion im Verlag auf Hochtouren lief. Denn, die Art und Weise, wie der junge Franzose und sein Verleger Fred Lautsch, den Weltfrieden herbeizuführen gedenken, das ist schon ganz schön ausgebufft. Für fünf Euro ist man dabei. Selten dass man für so wenig Geld so viel bekommt. Ein schönes, inhaltsreiches, amüsantes Buch ohne Altersbeschränkung. Jeder soll es haben. Es soll so vielen Menschen wie möglich in die Hände fallen. Denn, so wird es kommen: Bei allen Lesern werden plötzlich mit Blitz und Peng und Aha die Synapsen umschalten. „Ach, so siehts aus mit dem Libanon und den palästinensischen Flüchtlingen und den Israelis und mit dem Wissen darum, dass man eigentlich nichts weiß und mit den Toleranzen und mit dem Glück.“ Das leuchtet Jedem ein, der nach einer guten halben Stunde das Brevier zuklappt.
Ein wirklich guter Plan! Der dem Buch auch als Schema beiliegt. In der Mitte steht, worum es eigentlich geht: Glücklich sein! Das ist das Ziel seines Lebens. Sagt Mazas, der als Erzähler durch das Buch führt. Alles drumrum ist nur der Weg dahin. Jeden Tag Orangensaft trinken um Vitamine zu haben um gesund zu sein um schön zu sein ... um schließlich und endlich glücklich zu sein. Arabisch lernen, kochen können, tanzen gehen, seine Schwächen zeigen, Gedichte auswendig lernen – all das endet über Pfeilverbindungen und Blasen in der Mitte des Blattes immer mit: Glücklich sein. Und ist mit einer geradezu verblüffenden Logik auf fast Alles anwendbar. Mazas, der es schafft, die Welt mit Dreiecken und Vierecken so plausibel zu erklären, wie kein Philosoph vor ihm, ist ein wacher und sehr kreativer Geist. Seinen dreimonatigen Aufenthalt im Libanon hängte er an mehrere Jahre auf verschiedenen französischen Kunstschulen. Schließlich landete er in Berlin und ist jetzt Dipl.-Illustrator. Comiczeichner. Seine Eltern, sagt er, wollten, dass er lange studiert. Und das ganze Studium lang, sagt er auch noch, hat er gemacht, was er meinte, machen zu müssen, nicht, was seine Professoren von ihm wollten. Für sein Diplom hat er eine Eins gekriegt. Und dass ausgerechnet beim Mückenschweinverlag sein Weltverbesserungsversuch - übrigens ein Wort, das er sehr schätzt, weil man nur in der deutschen Sprache Wörter so großartig selbst zusammenbauen kann – in Druck ging, hat damit zu tun, dass er hier in Stralsund vor ein paar Jahren ein Praktikum absolviert hat. Und dachte: „Die Leute hier sind wirklich cool!“ Mit denen kann er es schaffen, die Welt zu verbessern. Er lebt jetzt in Berlin und Stralsund und bleibt noch ein bisschen im Speicher am Katharinenberg bevor er sowieso wieder da sein wird für sein nächstes Buch, das er neben seinen neuen Projekten mit palästinensischen Flüchtlingskindern im Libanon zeichnen will. Warum? Das wissen wir jetzt: Um das Problem der Flüchtlinge aus seiner speziellen und klugen Weltsicht heraus bekannt zu machen, um das Problem der Flüchtlinge zu lösen um den Konflikt in Nah-Ost zu lösen um die Welt zu verbessern um in Sicherheit zu leben und um, Ja, richtig: Um Glücklich zu sein.
Wladimir Kaminer liest aus seinem Buch „Mein Leben im Schrebergarten“
Wie wichtig ist uns Rharbarber? Haben wir je darüber nachgedacht? Muss erst ein Russe daherkommen, der die Angelegenheit mit dieser seltsamen Gartenfrucht ins Rampenlicht unseres Alltags rückt? Wladimir Kaminer ist jedenfalls der Meinung, es müsste der Genuss dieses äußerst zweifelhaften Kompotts im Test auf Einbürgerung aufgenommen werden. Er hat es sich angetan. Als Integrationsmaßnahme. Der grüne Schleim, der ihm da vorgesetzt wurde, schmeckte zwar nach Essig mit Zitrone, aber er spürte danach ein willkommenes Gefühl der Zugehörigkeit. „Das Leben in Deutschland ist kein Zuckerschlecken!“ Eben!
Es war im zweiten Teil der Lesung, zu der Kaminer am Montagabend in die Fachhochschule nach Stralsund eingeladen war, als er mit der Rharbarbergeschichte herausrückte. Sie stammt aus seinem Buch „Mein Leben im Schrebergarten“ und natürlich hat er sich mit der Aneignung einer solchen Scholle im Speckgütel Berlins auch etwas angetan, was sich nur ganz Mutige trauen: Der Eintritt in den Mikrokosmos eines Gartenvereins. Im ersten Teil seiner Lesung kündigte er sein nächstes Buch an. Es wird „Salve Papa“ heißen, erklärte er, weil seine Tochter im Gymnasium gerade Latein lernt, aber über die erste Vokabel bis zu den Herbstferien nicht hinausgekommen ist. Bildung in Deutschland. Ja, da fällt nicht nur Kaminer was Originelles ein. Und es ist auch nicht messerscharf, was er da über seinen Alltag als Familienvater und Schriftsteller so von sich gibt. Es ist ganz normal. Und deshalb umso amüsanter. Im Audimax der Fachhochschule wurde jedenfalls schon gejohlt, wenn sich wieder jemand aus der ersten Reihe erhob, weil die Tonqualität in den hinteren Sitzreihen erst als solche zu bezeichnen war. Da lacht man plötzlich also über Leute die Todesstreifen harken und über die Dissidenten der Kolonie, die Günter Grass heißen und es nicht wissen und heimlich Nadelbäume kultivieren. Ein Integrations-Genie ist er. Als Russe, der nur deutsche Bücher schreibt. Über den Alltag eben. Und die Bewältigung desselben. Und schräg ist ja nur der Vergleich mit dem, was uns trennt und dann doch nicht. Rharbarber ist, zugegeben, ein Grenzfall.
Es war im zweiten Teil der Lesung, zu der Kaminer am Montagabend in die Fachhochschule nach Stralsund eingeladen war, als er mit der Rharbarbergeschichte herausrückte. Sie stammt aus seinem Buch „Mein Leben im Schrebergarten“ und natürlich hat er sich mit der Aneignung einer solchen Scholle im Speckgütel Berlins auch etwas angetan, was sich nur ganz Mutige trauen: Der Eintritt in den Mikrokosmos eines Gartenvereins. Im ersten Teil seiner Lesung kündigte er sein nächstes Buch an. Es wird „Salve Papa“ heißen, erklärte er, weil seine Tochter im Gymnasium gerade Latein lernt, aber über die erste Vokabel bis zu den Herbstferien nicht hinausgekommen ist. Bildung in Deutschland. Ja, da fällt nicht nur Kaminer was Originelles ein. Und es ist auch nicht messerscharf, was er da über seinen Alltag als Familienvater und Schriftsteller so von sich gibt. Es ist ganz normal. Und deshalb umso amüsanter. Im Audimax der Fachhochschule wurde jedenfalls schon gejohlt, wenn sich wieder jemand aus der ersten Reihe erhob, weil die Tonqualität in den hinteren Sitzreihen erst als solche zu bezeichnen war. Da lacht man plötzlich also über Leute die Todesstreifen harken und über die Dissidenten der Kolonie, die Günter Grass heißen und es nicht wissen und heimlich Nadelbäume kultivieren. Ein Integrations-Genie ist er. Als Russe, der nur deutsche Bücher schreibt. Über den Alltag eben. Und die Bewältigung desselben. Und schräg ist ja nur der Vergleich mit dem, was uns trennt und dann doch nicht. Rharbarber ist, zugegeben, ein Grenzfall.
Abonnieren
Posts (Atom)